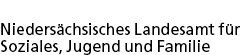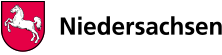Datenschutz in den Frühen Hilfen – Sozialdatenschutz, Hilfe oder Hemmnis
Einleitung
Dieser Artikel ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags beim PIAF®-Fachtag in Hildesheim am 10. Februar 2017, bei dem es um die Zusammenarbeit vor allem zwischen der Jugendhilfe und dem Gesundheitsbereich im Rahme der Frühen Hilfen ging. Die Ausführungen sind aber auch für alle anderen Bereiche der Jugendhilfe anwendbar.
Eigentlich ist die Aufgabe, in knapper Form etwas zum Sozialdatenschutz in der Jugendhilfe und dem Zusammenwirken mit anderen Professsionen zu erzählen unerfüllbar. Nicht etwa, dass im Datenschutz etwas ungeregelt und nicht hinreichend bestimmt ist, das Gegenteil ist der Fall. Es gibt eine Vielzahl von Datenschutzregelungen in verschiedenen Gesetzen und daher kann hier nicht auf alle Aspekte eingegangen werden. Daher sind diese Ausführungen als Versuch, eine Schneise in das Dickicht des Datenschutzes zu schlagen.
Viele kennen noch das gerade in den achtziger Jahren berühmte Buch von George Orwell mit dem Titel „1984"? Dort ging es mit der erfundenen Sprache „Neusprech" auch darum, das Bewusstsein der Menschen dadurch zu verändern, dass bestimmte Begriffe neu definiert wurden, euphemistische Bezeichnungen z.B. für das Überwachungsministerium eingeführt wurden - es heißt „Liebesministerium" und ist eigentlich das, was wir mit unseren heutigen Begriffen als „Stasi" bezeichnen würden. Gleiches gilt für die Wahl zum „Unwort" des Jahres, die seit vielen Jahren durchgeführt wird und bei der Worte ausgewählt werden, die eine besonders bösartige Konnotation enthalten. Warum ist das hier von Bedeutung?
Es fällt auf, dass oft in Diskussionen und Veranstaltungsankündigungen die Begriffe „Kinderschutz" und „Datenschutz" antagonistisch einander gegenübergestellt werden. Damit passiert aber etwas in unserer Wahrnehmung: auf der einen Seite steht das Wort „Kinderschutz". Hier geht es um kleine, oftmals hilfsbedürftige Kinder, die natürlich vor Unbill, vor Vernachlässigung oder gar Schaden bewahrt werden sollen und müssen. Dem gegenüber steht das Wort „Datenschutz", bei dem es - dem Wortlaut nach um den Schutz von Daten, also etwas „blutleeres" geht. Und damit verknüpft der Kopf, das Gehirn automatisch nicht nur ein Gegensatzpaar, sondern er gewichtet. Dabei ist dann sehr schnell klar, dass der Schutz von Kindern natürlich Vorrang haben muss vor dem Schutz von Daten. Diese unbewusst vorgenommene Gewichtung führt dann im Arbeitsalltag, aber auch in den Diskussionen über die Grenzen des Datenschutzes dazu, dass Datenschutz eher als Hindernis angesehen wird und diejenigen, die den Datenschutz betonen, offenbar nicht die Bedeutung des Kinderschutzes verstanden haben. Auch wenn das bewusst überzogen und zugespitzt ist, klingt dabei dann die Einschätzung durch: Datenschutz verhindert Kinderschutz!
Deshalb ist es wichtig, das Wort Datenschutz erst einmal genauer anzuschauen, bevor wir dann auf die einzelnen Aspekte des „Schutzes" in den Frühen Hilfen näher eingehen können.
Natürlich geht es eben nicht um den Schutz von Daten allgemein, sondern zunächst und immer um den Schutz der personenbezogenen Daten, also schlicht um Informationen über Menschen. Es geht um Daten, vertrauliche Daten, die Menschen von sich preisgeben oder andere Menschen und Institutionen über Menschen zusammentragen und die dann ein Bild und damit eine Einschätzung dieses Menschen erlauben. Der Datenschutz ist allgemein seit vielen Jahren ein Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat 1983 in dem wegweisenden und bis heute gültigen so genannten „Volkszählungsurteil" das Recht auf informationelle Selbstbestimmung festgeschrieben:
„1. Unter den Bedingungen der modernen Datenverarbeitung wird der Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfaßt. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen.
2. Einschränkungen dieses Rechts auf "informationelle Selbstbestimmung" sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Sie bedürfen einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage, die dem rechtsstaatlichen Gebot der Normenklarheit entsprechen muß. Bei seinen Regelungen hat der Gesetzgeber ferner den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Auch hat er organisatorische und verfahrensrechtliche Vorkehrungen zu treffen, welche der Gefahr einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts entgegenwirken
(BVerfG Urteil vom 15. Dezember 1983 Az. 1 BvR 209/83, 1 BvR 484/83, 1 BvR 440/83, 1 BvR 420/83, 1 BvR 362/83, 1 BvR 269/83 [Volkszählungsurteil])
Diese Grundaussagen sind auch unter den heute völlig veränderten Rahmenbedingungen der Datenspeicherung und -verarbeitung nach wie vor gültig.
Diese informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass jeder Mensch selber entscheiden können muss, was mit den Informationen über ihn selber geschieht, die er an Dritte, hier vor allem an offizielle Institutionen weitergibt. Im Bundesverfassungsgerichtsurteil wird dies als Quasi-Grundrecht mit der Begründung postuliert, dass es mit einer demokratischen Gesellschaftsordnung nicht vereinbar sei wenn „die Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Jeder von uns hinterlässt Tag für Tag Datenspuren, sei es beim Geldabheben, bei der Verwendung von Rabattkarten, im Internet oder mit dem Handy. Inzwischen ist allgemein bekannt, dass die Nutzung von Facebook, Youtube, Instagram, Whats-App oder Twitter zu einer Entblößung persönlicher und tw. privatester Daten führt, die sehr schnell zu sehr aussagekräftigen Persönlichkeitsprofilen zusammengestellt werden können. Wem ist es nicht schon passiert, dass bei Amazon oder Ebay auf einmal Vorschläge für Käufe gemacht werden, die auf der Basis der zuletzt aufgerufenen Suchergebnisse natürlich ein Persönlichkeitsprofil erstellt und die Vorschläge dann passgenau herausgesucht haben. Das ganze erfolgt automatisch durch entsprechende Suchroutinen und ist - trotz aller rationalen Erklärungsgründe - ziemlich unheimlich.
Da erscheint es eher antiquiert, dass öffentliche Stellen, die dann auch noch für die Betroffenen das Beste wollen, nämlich den Familien und vor allem den Kindern helfen, durch „übertriebene" Datenschutzbestimmungen daran gehindert werden. Das jedenfalls ist der durchaus bekannte Tenor und das vermittelt ja auch der Titel dieser Veranstaltung. PIAF® ist etwas Gutes, da arbeiten - wie vom Gesetzgeber gewünscht verschiedene Professionen aus der Jugendhilfe und dem Gesundheitsbereich zusammen, um den Kindern ein gesundes frühes Aufwachsen zu ermöglichen und dann dürfen Sozialdaten nicht so ohne Weiteres ausgetauscht werden - das ist doch eigentlich ein Skandal oder zumindest unverständlich!
Dieser Reflex ist erst einmal nachvollziehbar, richtig ist er dennoch nicht. Warum das so ist, wird im Folgenden erläutert.
Grundsatzfrage
Spätestens seit Volkszählungsurteil 1983 des Bundesverfassungsgerichtes ist bekannt, dass es das ureigenste Persönlichkeitsrecht eines Menschen ist, selber darüber entscheiden zu können, welche Daten von ihm selber gespeichert und weitergegeben werden dürfen, weil derartige Daten, möglicherweise dann noch mit anderen Daten verknüpft oder in einen anderen Zusammenhang gestellt, auch ein fehlerhaftes, sogar falsches und abträgliches Bild eines Menschen erzeugen können. Insofern geht es nicht um „Datenschutz" versus „Kinderschutz", sondern um verschiedene Persönlichkeitsrechte.
Aber es geht bei der Frage des Datenschutzes natürlich nicht allein um das Abwägen von Rechts- oder Grundrechtsfragen. Gerade in den hier thematisierten Hilfebereichen, seien es Gesundheits- oder Jugendhilfe gehören vertrauensvolle persönliche Beziehungen zwischen den Eltern und den Vertreterinnen und Vertretern der Institutionen und Behörden zur konstitutionellen Grundlage der Arbeit. Spätestens wenn Probleme, Schwierigkeiten, Versäumnisse, Krankheiten Thema werden (müssen), funktioniert eine Beziehung nur dann, wenn innerhalb dieser Beziehung und der damit verbundenen Kommunikation Vertrauen darüber herrscht, dass die anvertrauten Daten nicht missbraucht werden. Für die Betroffenen heißt dabei Missbrauch oft schon, dass diese überhaupt einer anderen Person anvertraut werden, weil damit die Sorge verbunden ist, dass diese Person, die sie nicht kennen, ihre Daten in einer Weise verwendet, die nicht mehr kontrollierbar und beherrschbar sind.
Mit dem Wort „Vertrauen" schwingen einige andere Begriffe mit, die verdeutlichen, was damit gemeint ist. Es geht um „trauen", sprich darum, überhaupt intimes, vielleicht auch Belastendes, Problematisches anzusprechen, auszusprechen. Es geht aber auch um „anvertrauen", das heißt jemand anderem diese Informationen zu erzählen und sie nicht für sich zu behalten. Es geht dabei dann auch um „Treue" und „Treuhänderschaft" bei denjenigen, denen die Daten anvertraut werden. Es geht beim Datenschutz also um etwas ganz anderes als den Schutz von Daten. Es geht um den Schutz von Menschen in Vertrauensbeziehungen. Und damit schließt sich der Kreis zum Ausgangswort „Vertrauen", also demjenigen, dem diese intimen Informationen anvertraut wurden zu vertrauen, dass diese Daten nicht Dritten zur Kenntnis gelangen und gegen die Person, die diese Daten preisgegeben hat, zu deren Schaden verwendet werden können. Gerade in Situationen, in denen die Betroffenen oft selber wissen oder zumindest ahnen, dass sie etwas getan haben oder sie sich in einer Situation befinden, die nicht unproblematisch ist, herrscht große Angst vor den Konsequenzen. Es ist gerade diese Angst, mithin etwas Irrationales, was dann verhaltensleitend wird und tw. zu Verhaltensweisen und Reaktionen führt, die nicht gewollt. Für die Arbeit im Kinderschutz, in den Frühen Hilfen ist Offenheit und Vertrauen, ist Angstabbau und Verständnis zentral wichtig.
In nicht wenigen Fällen geht es zudem mit Menschen in belastenden und belasteten Situationen, die oft genug in ihrem Leben Vertrauensbrüche und Vertrauensverluste erfahren haben. Für diese Menschen ist das Herstellen von Vertrauen und das Anvertrauen intimer, vielleicht auch belastender Details ihres Lebens ein dünnes Eis, auf dem sie sich bewegen. Im Gesundheits- und Jugendhilfe-Bereich geht es dann zudem oft auch noch um eine belastete Beziehung zum Kind und die große Sorge, dass das Jugendamt möglicherweise bei Kenntnis von belastenden Situationen das Kind wegnimmt. Im Landesjugendamt werden ganz oft mit Petitionen von Menschen vorgelegt, die sich über Jugendämter beklagen, weil diese aus Sicht der Betroffenen das Kind zu Unrecht „weggenommen" haben. Unabhängig von den tatsächlichen Gründen der Inobhutnahme oder Herausnahme aus der Familie und der i.R. mangelnden Einsicht in die Gründe dafür klingt immer eine massive Betroffenheit gerade bei diesem sensiblen Thema mit. Auch dazu gibt es einen bemerkenswert deutlich formulierten Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 24.05.1977. Damals stellte das BVerfG im Zusammenhang mit einem Urteil über die Arbeit einer Drogenberatungsstelle die Bedeutung des Vertrauensschutzes fest. Die Richter stellten klar, dass ein Klient sich nicht öffnen wird, wenn er davon ausgehen muss, dass seine Daten Dritten zugänglich werden. Das „rückhaltlose" d.h. ohne weitere Absicherung erfolgende sich Öffnen in Beratungsgesprächen ist aus Sicht des Gerichtes für die wirksame Hilfe der Beratungsstelle unverzichtbar und, wie es ausdrücklich heißt „Grundlage für die funktionsgerechte Tätigkeit der Beratungsstelle". Schließlich unterschätzen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter z.B. im Jugendamt immer wieder ihre Wirkung als „Amtspersonen". Trotz eines noch so emphatischen, noch so freundlichen, verständnisvollen und zugewandten Umgangs und Auftretens repräsentieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer das „Amt", den Staat und damit eine strukturell mächtige und für die Betroffenen übermächtige Institution. Alle Hilfen gerade in den Frühen Hilfen mögen noch so offen formuliert, noch so gut begründet, noch so unterstützend sein, sie kommt vom Amt, vom Staat und sind damit strukturell und potentiell bedrohlich. Das nehmen die Mitarbeitenden der Jugendämter das möglicherweise gar nicht (mehr) bewusst war, aber als Personen sind sieaus Sicht der Menschen, die sie unterstützen wollen, immer ausgestattet mit der ganzen Machtfülle des Jugendamtes bzw. des Staates. Und spätestens, wenn in der helfenden Funktion „gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung" wahrgenommen werden, sind sie nicht mehr die helfende Person, sondern müssen „qua Amt" tätig werden. Insofern ist diese gefühlte Ambivalenz in der Realität ja tatsächlich vorhanden.
Es sind diese strukturellen Rahmenbedingungen, die es oft erschweren, Vertrauen in die Personen zu fassen, die das Amt, die den Staat repräsentiert. Das dies eine für bestimmte Berufsgruppen grundlegend wichtige Voraussetzung ist, ergibt sich aus daraus, dass der Gesetzgeber es für erforderlich gehalten hat, eine Rechtsregelung für Geheimnisträgerinnen und Geheimnisträger, den § 203 StGB zu treffen. Dort sind bestimmte Berufsgruppen aufgeführt wie Ärztinnen und Ärzte, Heilberufe mit staatlicher Anerkennung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Beratungsstellen, staatlich anerkannte sozialpädagogische Fachkräfte u.a. , denen es bei Strafe ausdrücklich untersagt ist, ein „fremdes Geheimnis", insbesondere ein zum „persönlichen Lebensbereich"§ gehörendes zu offenbaren.
Diese Klarstellung ist deshalb wichtig, um diesen scheinbaren Gegensatz zwischen Kinderschutz und Datenschutz bzw. die vermeintliche, eingangs angesprochene Hierarchie zwischen diesen beiden Begriffen und den dahinter stehenden Aufträgen zu klären.
Die Grundregeln des Sozialdatenschutzes
Es ist nun etwas nicht so - das wäre in Deutschland auch ungewöhnlich - das es zu wenige Regelungen des Datenschutzes und des Sozialdatenschutzes hätten. Eher ist das Gegenteil der Fall. Neben dem Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes gibt es das Bundesdatenschutzgesetz, das Niedersächsische Datenschutzgesetz und dann die sozialgesetzliche Regelungen insbesondere in den Sozialgesetzbüchern I und X sowie als fachlich spezifische Regelung die des Sozialgesetzbuches VIII. Hinzu kommen noch spezielle Regelungen der Datenweitergabe für Berufsgeheimnisträger z.B. im Bundeskinderschutzgesetz. Hier wird sich auf die wesentlichen Regelungen beschränkt und insbesondere die Regelungen des Sozialgesetzbuches beleuchten.
Zu Beginn dieses Teils ist der Verweis auf den § 203 des Strafgesetzbuches wichtig. Die dort formulierte sogenannte „Verschwiegenheitspflicht", die allgemein für Ärztinnen und Ärzte, Pfarrerinnen und Pfarrer oder Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte bekannt ist gilt, und das ist eben nicht mehr allgemeines Wissen, auch für Sozialarbeiterinnen/-arbeiter/-pädagoginnen/-pädagogen mit staatlicher Anerkennung, also für einen wesentlichen Teil der in der Jugendhilfe beschäftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Privatgeheimnisse (es geht hier noch nicht um Sozialdaten), die einem dieser Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger anvertraut wurden oder zur Kenntnis gelangen, dürfen nicht weitergegeben werden. Diese Vorschrift ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr (oder Geldbuße) bewehrt. Wichtig ist aber vor allem, dass dieses Berufsgeheimnis professionsbezogen ist. Es ist also ohne Belang, wo man arbeitet und ob der Anstellungsträger entsprechende eigene abweichende, ggf. weniger strenge Datenschutzregeln festgelegt hat. Sobald man in dieser Profession seinen Beruf ausübt, gilt dieser Schutz des Privatgeheimnisses uneingeschränkt. Das z.B. ist nicht immer bekannt und wird auch nicht immer akzeptiert. Gerade in Behörden nehmen Behördenleitungen für sich in Anspruch, alle Informationen oder gespeicherte Daten in ihrer Vorgesetztenfunktion einsehen zu dürfen. Das aber ist gerade auf Grund dieser professionsbezogenene Regelung nicht so einfach möglich, weil hier die gesetzliche Regelung Vorrang hat.
Neben dieser auf die Profession bezogenen Regelung gibt es dann die zahlreichen prozessbezogenen allgemeinen und speziellen Datenschutzregelungen. Grundlegend ist dabei zunächst erst einmal der § 67 SGB X. Dort heißt es „(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden."
Damit sind drei wesentliche Angaben gemacht:
- Es sind konkrete Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
- Es muss sich um eine konkrete natürliche Person handeln, vulgo einen Menschen
- Es sind Daten, die von einem Leistungsträger erhoben, gespeichert oder verarbeitet werden.
Das heißt, alle Daten, die die persönlichen oder sachlichen Umstände eines Menschen beschreiben, sind dann Sozialdaten, wenn sie von einer öffentlichen staatlichen oder in staatlichem Auftrag tätigen Stelle erhoben werden. Damit ist zunächst erst einmal klar, was eigentlich Sozialdaten sind. Damit ist aber schon deutlich, worin sich Sozialdaten von Daten unterscheiden, die wir z.B. bei Facebook oder anderswo im Internet hinterlassen. Hier muss eine bestimmte, als Leistungsträger bezeichnete Stelle tätig werden und Daten über eine konkrete Person erfassen und erheben. Leistungsträger sind dabei alle Behörden, Anstalten oder Körperschaften, die für die Erbringung von Sozialleistungen zuständig sind. Erst dadurch, dass die oben genannten personenbezogenen Daten von diesen erhoben werden, sind sie Sozialdaten im sozialrechtlichen Sinn. Zudem müssen diese Daten ausdrücklich einer Person zugeordnet werden können bzw. Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zulassen. Das ist ja auch nachvollziehbar, denn die erhobenen Sozialdaten sind Grundlage für die Erbringung von konkreten Sozialleistungen, die sich ja an eine bestimmte Person richten müssen.
In dem Moment, in dem diese Daten z.B. für statistische Zwecke erhoben und erfasst werden und kein Rückschluss auf eine konkrete Person möglich ist, sind es keine Sozialdaten im sozialrechtlichen Sinn, weil dann ja der personenbezogene Zweck dieser Sozialdaten nicht mehr möglich ist.
Der § 35 SGB I legt dann fest, dass diese erhobenen Sozialdaten dem Sozialgeheimnis unterliegen. Eindeutig heißt es da: „(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis)." Das bindet die Leistungsträger eindeutig. Dieser Individualanspruch, der die informationelle Selbstbestimmung des „Volkszählungsurteils" von 1983 wieder aufnimmt, verpflichtet die Leistungsträger dazu, diese Daten nicht ohne Wissen und Einwilligung der betroffenen Person zu erheben. Nur so kann die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes verwirklicht werden, dass jeder Mensch wissen muss, was der Staat über ihn weiß. Hinzu kommt übrigens noch der Punkt, dass auch der Gesetzgeber nur die Daten erheben darf, die unbedingt erforderlich sind. Einfach so Daten auf Vorrat zu erheben, weil man sie gerne wissen würde oder vielleicht künftig benötigt, ist lt. Bundesverfassungsgericht nicht zulässig, weil unverhältnismäßig.
Der § 35 SGB I untersagt zudem die Weitergabe innerhalb des Leistungsträgers an Personen, die nicht mit der Erfüllung der Aufgabe, für die sie erhoben wurden, befasst sind. .Aus dieser Regelung erwächst die uns allen bekannte Tatsache, dass Akten, die Sozialdaten enthalten, verschlossen aufbewahrt werden müssen.
Neben den „allgemeinen" rechtlichen Bestimmungen zum Sozialgeheimnis und dem Sozialdatenschutz in den Sozialgesetzbüchern I und X gibt es dann noch als „lex specialis" die Regelungen im SGB VIII. Diese sind gegenüber den Regelungen des SGB I und X vorrangig anzuwenden, weil sie spezifische Regelungen für den Bereich der Jugendhilfe mit ihren besonderen inhaltlichen Spezifika enthalten und damit eine Ausformung der allgemeineren Bestimmungen in den anderen Sozialgesetzbüchern sind. Das wird insbesondere deutlich in der Abwägung zwischen Sozialgeheimnis und Kinderschutz.
Was besagen diese Regelungen nun im Einzelnen?
Auch hier soll sich auf die Kernaussagen beschränkt und diese dargestellt werden. So schreibt der § 62 SGB VIII vor, dass Sozialdaten nur erhoben werden dürfen, soweit dies für die Aufgabenerfüllung unerlässlich ist. Auch hier findet sich wieder die ausdrückliche Beschränkung darauf, nur dann überhaupt Daten zu erheben, wenn es erforderlich ist und dann auch nur die Daten zu erheben, die wirklich nötig sind. Das fordert von den Jugendämtern einen sehr bewussten Umgang mit den Sozialdaten der Betroffenen und zwingt immer wieder dazu, ernsthaft zu reflektieren, ob die Datenerhebung wirklich und wenn ja in dem geplanten Umfang erforderlich ist. Dabei ist – dieser Hinweis ist hier erforderlich - immer der Blickwinkel des Betroffenen und nicht der Blickwinkel der Behörde einzunehmen. Es darf nicht nach dem Motto gehen: „Ach, das wüsste ich auch noch gerne" sondern ausdrücklich nach dem Motto: „Reichen diese Daten nicht tatsächlich aus?". Also: weniger ist hier Trumpf. Prof. Wiesner formuliert das in seinem Kommentar zum SGB VIII ausdrücklich mit den Worten: „Keine Datensammlung ´auf Vorrat`"! Weiterhin sind die Sozialdaten grundsätzlich beim Betroffenen zu erheben (§ 62 Abs. 2 SGB VIII). Sie sind nur in besonderen Ausnahmefällen befugt, die Daten anderweitig zu beschaffen, ansonsten gilt der eben genannte Grundsatz. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man das schon mehrfach angesprochene Volkszählungsurteil heranzieht. Das dort verankerte „Recht auf informationelle Selbstbestimmung" kann nur dann ernsthaft wahrgenommen werden, wenn die jeweilige Person überhaupt weiß, dass bestimmte Daten erhoben werden. Das Recht des Leistungsträgers, diese Daten zu erheben, schließt ja ausdrücklich das Recht des Betroffenen ein, die Angabe der Daten auch zu verweigern. Dieses Rechts läuft aber leer, wenn der Betroffene nicht weiß, dass Daten über ihn erhoben werden.
Um das Ganze im Alltag noch etwas komplizierter zu machen, müssen die Betroffenen auch noch aufgeklärt werden, warum diese Daten über ihn erhoben werden sollen. Bei dieser Aufklärung muss nicht nur auf die Rechtsgrundlage der Erhebung und den Zweck hingewiesen werden, sondern auch auf die Verwendung. Ausnahme, so schreibt es das Gesetz vor, ist nur dann erlaubt, wenn diese offenkundig sind, sich also aus dem Gesamtzusammenhang von selbst ergeben. Wichtig dabei ist aber noch etwas Anderes: als Erhebung sind nicht nur die Datenerfassung in Fragebögen oder Eingabemasken gemeint, die damit ja bereits festgehalten werden; unter Erhebung ist auch das Gespräch der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters mit dem Klienten zu verstehen, in dem in Form einer vertrauensbildenden Beziehungsarbeit natürlich auch persönliche Informationen ausgetauscht werden und ggf. letztlich in einem Aktenvermerk landen. Auch das sind „Daten" in dem hier gemeinten Sinne, weil das natürlich auch Einzelangaben über persönliche und sächliche Verhältnisse einer bestimmten Person sind. Um es jetzt noch komplizierter zu machen: wenn in diesem Gespräch Informationen über Dritte ausgetauscht werden (Partner, Eltern, Freunde) und das ist gerade in der Arbeit in der Jugendhilfe eigentlich unvermeidbar, sind auch das Sozialdaten von Betroffenen, die zur Kenntnis gelangen und mit denen ausgesprochen sensibel umgegangen werden muss. Streng genommen müsste das Gespräch dann beendet werden und die Einwilligung des Dritten eingeholt werden. An dieser Stelle wird aber deutlich, dass diese theoretische Konstruktion dann realitätsfern und unrealistisch wird. Im § 62 Abs. 4 SGB VIII gibt es daher eine Art „Auffangklausel", die diese Form der Datenerhebung auch ohne Beteiligung und Einwilligung „des Betroffenen" erlaubt, „wenn die Kenntnis dieser Daten für die Gewährung einer Leistung nach dem SGB VIII notwendig ist".
In dieser Vorschrift gibt es dann auch eine abschließende Aufzählung von Tatbeständen, in denen eine Datenerhebung ohne Mitwirkung des Betroffenen zulässig ist. Ein zentraler Punkt ist dabei die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8 a SGB VIII.
Wenn nun auf diese Weise Sozialdaten erhoben und erfasst worden sind, stellt sich die Frage, was nun damit geschehen darf oder soll.
Auch da hat das SGB VIII klare Vorschriften. Zunächst - das greift dann die Regelungen des § 35 SGB I wieder auf - dürfen Sozialdaten nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie erhoben wurden. Es ist also unzulässig, innerhalb des Jugendamtes vorliegende Daten, die z.B. im Zusammenhang mit Frühen Hilfen erfasst wurden, einfach weiterzugeben, wenn es dann z.B. um die Abschätzung erzieherischer Hilfen geht. Es dürfte auch klar sein, warum das so ist: hier „schlägt“ wieder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, durch. Möglicherweise wären bestimmte persönliche Daten vom Betroffenen nicht angegeben worden, wenn von vornherein die weitere Zweckbestimmung bekannt gewesen wäre.
Auch mit der Weitergabe von Daten ist das so eine eigene Sache. Innerhalb des Jugendamtes, das ja eine besondere bundesgesetzlich definierte Behörde ist (unabhängig von der Benennung und kommunalen Ämterstruktur), ist eine Datenweitergabe nur zulässig,
- wenn der/ die Betroffene dem zugestimmt hat
- u.a. an Kolleginnen und Kollegen bei Fallwechsel oder Abschätzung des Gefährdungsrisikos bei Fällen von § 8 a SGB VIII auch ohne Zustimmung des/ der Betroffenen
Besonders kompliziert wird es aber, wenn es um Datenweitergabe an Dritte innerhalb der Kommunalverwaltung, aber außerhalb des Jugendamtes geht. Hier wird die Stelle erreicht, in der es schon von Bedeutung ist, dass das Jugendamt als Behörde oder Verwaltungseinheit lt. § 69 Abs. 3 genau definiert ist. Ein Jugendamt dient nämlich zur Wahrnehmung „der Aufgaben nach diesem Buch", sprich dem SGB VIII, gleich, wie die konkrete Aufgabenverteilung in der Kommunalverwaltung geregelt ist. Damit gilt die Bestimmung des Abs. 2a, der fordert, dass dann die Daten zu pseudonymisieren bzw. zu anonymisieren sind
Auch dafür gibt es im § 67 des SGB X folgende Begriffsbestimmungen:
„(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
(8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren."
Ziel beider Verfahren ist es, den Sachverhalt zur Einschätzung darstellen und damit die Beratung und Einschätzung fachlich zu ermöglichen, ohne einen Rückschluss auf eine konkrete Person möglich zu machen. Das Verfahren gilt übrigens auch bei der Beratungsmöglichkeit von Berufsgeheimnisträgern gem. § 4 des Bundeskinderschutzgesetzes. Auch hier ist die Anonymisierung und Pseudonymisierung der Sozialdaten vor der Weitergabe an die beratenden Fachkräfte des Jugendamtes zwingend vorgeschrieben. All diese Regelungen gelten nur dann, wenn der/ die Betroffene einer Datenweitergabe nicht zugestimmt hat. Es ist daher immer vorzuziehen, dass bei der Erhebung von Sozialdaten, gleich in welcher Form, diese Datenweitergabe erlaubt wird. Weiter oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass ohnehin lt. Gesetz die Betroffenen über die Datenerhebung aufgeklärt werden müssen und das wäre dann auch der geeignete Anlass, darüber zu sprechen, dass eine Weitergabe der Daten erlaubt wird.
Allerdings muss diese Weitergabe genau beschrieben und Umfang und Dauer der Weitergabe ebenso festgeschrieben werden, wie der Zweck derselben. Eine unbefristete und unbestimmte Schweigepflichtsentbindung ist deshalb nicht wirksam, weil sie dem gesamten Sinn und Zweck des Sozialdatenschutzes widersprechen würde. Auch hier gilt, dass der/ die Betroffene wissen muss und auch darüber entscheiden können muss, wer außer der Person, mit der gerade das Gespräch geführt wird, Einsicht in seine/ ihre Daten erhält. Schon aus diesem Grund sollte in einer Schweigepflichtsentbindung
- der Zweck erläutert werden (warum müssen diese Daten weitergegeben werden?
- der Personenkreis konkret, ggf. sogar unter Namensnennung genannt werden und
- ein fester Zeitraum bestimmt werden. Dieser sollte sich unmittelbar an dem Erhebungszweck orientieren und einen Zeitraum umfassen, der auch von dem/ der Betroffenen übersehen werden kann, also i.R. nicht über mehrere Jahre reichen.
Insgesamt gilt auch bei der Schweigerechtsentbindung, dass diese so konkret wie möglich ist und die Datenweitergabe und -nutzung im Sinne des Sozialdatenschutzes so eng wie möglich gefasst wird. Auch hier gilt, dass die Personen, die in Folge einer derartigen Schweigerechtsentbildung die Daten erhalten, diese nur zu dem Zweck nutzen dürfen, zu dem sie erhoben wurden und ohne Zustimmung des/ der Betroffenen natürlich auch nicht weitergeben dürfen.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine Behörde, gleich in welch guter Absicht sie Daten erhebt,
- nur die unmittelbar erforderlichen Daten erheben darf,
- diese nur bei dem/ der Betroffenen erhoben werden dürfen,
- diese treuhänderisch zu verwalten sind (es bleiben die Daten des Betroffenen und sie gehen nicht in das „Eigentum" der Behörde über),
- im Zweifelsfall einmal mehr als einmal zu wenig die Zustimmung des/ der Betroffenen einholen sollte.
Dahinter steckt eine Sichtweise von Behörde auf Klienten, die von immenser Bedeutung ist.
Gerade in den Frühen Hilfen schleicht sich leicht unbewusst die Einschätzung ein, dass es hier ja darum geht, Familien, vor allem Kindern zu helfen. Da es aber etwas „Gutes" ist, was hier erfolgt, ist es doch eigentlich schwer einzusehen, dass die Datenerhebung und Weitergabe nicht so einfach möglich ist, sondern offenbar eher ein Hemmnis darstellt, eben dieses Gute auch zu tun. Aber hinter einer derartigen Sichtweise steckt unbewusst eine hierarchische, patriarchalische oder matriarchalische Sichtweise, die den Klienten nicht als auf gleicher Augenhöhe wahrnimmt. Das ist gerade bei der Jugendhilfe und den anzubietenden Hilfen weder abwertend noch böse gemeint und trotzdem passiert diese unbewusste Hierarchisierung immer wieder.
Dann kommt es aber auch zu der Einschätzung, dass Datenschutz ein Hemmnis ist oder sein kann es wird einmal mehr deutlich, wie Eingangs ausgeführt, dass Begriffe, dass Sprache Bewusstsein formt und möglicherweise dann auch Verhalten steuert.
Eine Weitergabe ist ohne Zustimmung der Betroffenen nur dann möglich, wenn es einen Verdacht oder, wie es im Gesetz heißt „gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung" gibt. Aber auch hier steckt der Teufel im Detail. Eine Kindeswohlgefährdung im rechtlichen Sinne ist etwas anderes, deutlich schwerwiegenderes, als es landläufig verstanden wird. Der Begriff „Kindeswohlgefährdung" ist rechtlich weitaus enger gefasst, als es gemeinhin im Alltag verstanden wird. Nicht jede Beeinträchtigung, Benachteiligung oder Vernachlässigung ist eine Kindeswohlgefährdung, die zur Folge hat, dass das Sozialgeheimnis aufgehoben ist.
Als Kindeswohlgefährdung gilt bereits seit den 1950er Jahren „eine gegenwärtige in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lasst" (BGH FamRZ. 1956, S. 350). Gemäß dieser Definition müssen drei Kriterien gleichzeitig erfüllt sein, damit von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen ist:
- Die Gefährdung des Kindes muss gegenwärtig gegeben sein.
- Die gegenwärtige oder zukünftige Schädigung muss erheblich sein.
- Die Schädigung muss sich mit ziemlicher Sicherheit vorhersehen lassen, sofern sie noch nicht eingetreten ist.
Voraussetzung ist also nicht nur die Beeinträchtigung des Kindeswohls durch ein bestimmtes Verhalten oder Unterlassen, sondern auch und vor allem die nachhaltig negative Wirkung dieses Verhaltens / Unterlassens, genauer: die körperliche, geistige oder seelische Schädigung des betroffenen Kindes. Erst dann spricht man vom Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung.
Nicht jede „Abweichung" vom Familien- und Erziehungsbild der bürgerlichen Familie ist daher eine Kindeswohlgefährdung in den Definitionen, die Grundlage der entsprechenden rechtlichen Regelungen sind.
Die Schwelle ist deshalb so hoch, weil es nicht nur um den Eingriff in Persönlichkeitsrechte geht, sondern insbesondere das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und das Grundrecht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder ohne staatliche Bevormundung, wie es der Artikel 6 des Grundgesetzes als historische Erfahrung aus der Nazizeit festgeschrieben hat, hier miteinander abgewogen werden müssen. Ein Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Elterngrundrecht ist erst dann zulässig, wenn die Rechte des Kindes auf Unversehrtheit massiv und unmittelbar oder mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet sind.
Erst dann greifen auch die Regelungen zur Kindeswohlgefährdung. Das Verfahren bei Vorliegen von „gewichtigen Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefährdung" ist sehr umfänglich im § 8 a des SGB VIII geregelt. Dort ist vorgeschrieben, dass es zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos mindestens zwei Fachkräfte des Jugendamtes geben muss. Diesen ist es ausdrücklich für diesen, und nur für diesen Zweck erlaubt, die entsprechenden Sozialdaten untereinander auszutauschen So ist es ausdrücklich im § 65 SGB VIII, Abs. 1 Ziffer 4 geregelt. Das gilt allerdings nur für die Fachkräfte des Jugendamtes, für Fachkräfte außerhalb des Jugendamtes müssen diese Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden (§ 64 Abs. 2 SGB III).
Das Bundeskinderschutzgesetz regelt die Datenweitergabe auch für außerhalb des Jugendamtes stehende Personen, die gemeinhin als Geheimnisträger bekannt werden. Der dort im § 4 BKiSchG benannte Personenkreis, (u.a. auch Hebammen oder Lehrkräfte) können sich beim Jugendamt zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung Beratung einholen. Dafür dürfen sie der „insoweit erfahrenen Fachkraft" die erforderlichen Daten übermitteln, die allerdings vor der Übermittlung zu pseudonymisieren sind (dieser Begriff ist im § 67 SGB X im Abs. 8a definiert).
Erst wenn eine Abwendung der Gefährdung z.B. durch eine Erörterung mit den Betroffenen und das Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen nicht möglich ist oder der Schutz des Kindes dadurch gefährdet wird, haben sie das Recht, das Jugendamt zu informieren. Allerdings gilt hier - wie eigentlich immer dann, wenn eine Datenweitergabe zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung erforderlich ist und die Betroffenen nicht zustimmen - dass diese darüber informiert werden müssen. Dieses Transparenzgebot ist vor allem deshalb wichtig, weil damit wenigstens ein dünner Faden Vertrauen noch erhalten werden kann. Es bleibt dabei, dass es immer wieder Auftrag ist, zu den Betroffenen ein Verhältnis aufrechtzuerhalten, das es ermöglicht, auch später wieder mit den Betroffenen arbeiten zu können.
Wenn es z.B. in Folge einer festgestellten Kindeswohlgefährdung zu einer Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII gekommen ist, dann ist das Jugendamt bis zum Vorliegen einer familiengerichtlichen Entscheidung befugt und beauftragt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes erforderlich sind (Abs. 2). Dazu zählt auch eine Unterrichtung z.B. der Kita bzw. der Schule, auch um diesen Stellen die Möglichkeit zu geben, sich auf diese Situation entsprechend einstellen zu können. Eine derartige Weitergabe von Informationen ist dann auch ohne Einwilligung der Eltern möglich, weil sie ja an deren Statt erfolgt. In jedem Fall allerdings ist zu prüfen, ob eine entsprechende Datenweitergabe dem Wohl des Kindes gerecht wird.
Anders gelagert ist der Fall der Amtsermittlung z.B. durch Polizei oder Familiengericht. Wenn diese z.B. im Fall eines Verfahrens gem. § 1666 BGB in einem Kindergarten nachfragen, um dort für die Beurteilung des Sachverhaltes relevante Informationen zu bekommen, gibt es in den einschlägigen sozialrechtlichen Regelungen Hinweise darauf, dass das zu einer Ausnahme vom Sozialgeheimnis führen kann. Insofern wäre in einem derartigen Fall zunächst davon auszugehen, dass keine personenbezogenen Daten ohne Einwilligung der Betroffenen bzw. der Personensorgeberechtigten weitergegeben werden. Eine telefonische Anfrage ist in jedem Fall durch eine schriftliche abzulösen und es ist dann von der Beurteilung in jedem Einzelfall abhängig, ob es Ausnahmen vom Sozialgeheimnis geben darf, weil das Rechtsgut des Kindesschutzes dann höher einzuschätzen ist. Das muss - ggf. unter Einbezug von Rechtskundigen - geprüft werden.
Es gibt als eine weitere Ausnahme noch den „rechtfertigenden Notstand" gem. § 34 StGB. Diesen erwähne ich hier nur der Vollständigkeit halber, wer sich die Vorschrift durchliest, wird feststellen, dass dieser in der Jugendhilfe und den Frühen Hilfen (hoffentlich) nicht auftritt und mithin handlungswirksam wird.
Zusammenarbeit der Professionen in den Frühen Hilfen
Die Frühen Hilfen sind von der Grundintention darauf angelegt, die Professionen, die Kontakt zu Familien und Kindern haben bzw. deren gesetzlicher Auftrag dies ist, stärker als vordem zusammenarbeiten sollen. Dahinter steckt einerseits eine Umsetzung der Grundaussage des 12. Kinder- und Jugendberichtes der Bundesregierung „Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung" aus dem Jahr 2006, andererseits die Erkenntnis aus der öffentlichen Kinderschutzdebatte, dass viele Kinderschutzfälle wegen Kommunikationsbrüchen zwischen den Professionen entstanden sind. Diese Kommunikation nicht nur zu verbessern, sondern strukturell anders zu organisieren und aufzustellen, ist das Ziel insbesondere der Netzwerke „Frühe Hilfen". Von den im KKG aufgezählten Netzwerkpartnern ist neben der Jugendhilfe vor allem der Gesundheitsbereich und hier die Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte in Krankenhäusern, den Gesundheitsämtern und den privaten Arztpraxen sicherlich der bedeutendste. Allerdings gestaltet sich die Zusammenarbeit aus drei Gründen nicht immer reibungslos:
- Die Teilnahme an Treffen und Sitzungen des Netzwerkes Früher Hilfen wird nicht vergütet, ist daher für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ein „Verlust".
- Die Regeln des Sozialdatenschutzes verhindern, dass der Gesundheitsbereich vom Jugendamt eine Rückmeldung bekommt, wenn der/ die Betroffene nicht zugestimmt hat
- Nicht immer begegnen sich sozialpädagogische Fachkräfte und Ärztinnen und Ärzte gefühlt oder tatsächlich auf Augenhöhe.
Natürlich ermöglichen die Regelungen des Sozialdatenschutzes und des § 4 KKG bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung eine Weitergabe von Daten, allerdings beklagen Ärztinnen und Ärzte immer wieder die aus ihrer Sicht fehlende Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Festgemacht wird dies auch bei der Evaluation des Kinderschutzgesetzes 2016 daran, dass die Jugendämter i.R. keine Rückmeldung geben, ob und was sie mit den übermittelten Informationen gemacht haben. Nicht selten wird vom Gesundheitsbereich das Jugendamt als „schwarzes Loch" bezeichnet. Das Problem dabei ist der Umstand, dass das Jugendamt, wie vorstehend beschrieben, ohne Zustimmung der Betroffenen keine Rückmeldungen geben darf. Lediglich auf den Eingang der Meldung und dass diese gemäß den nach § 8 a SGB VIII in den Jugendämtern vereinbarten Regularien bearbeitet werden, dürfte zurückgemeldet werden. Aber schon jeder Hinweis darauf, ob es sich tatsächlich um eine Kindeswohlgefährdung handelt, ist vom Schweigegebot des Sozialdatenschutzes umfasst. Das „Suchtberatungsurteil" des BVerfG von 1977, daran sei erinnert, legt bewusst diese Schwelle so hoch, um ein - wie es dort ja heißt - „rückhaltloses" Offenbaren der Klienten zu ermöglichen und mithin den dafür erforderlichen Vertrauensschutz zu sichern. In dem im Sommer 2016 bekannt gewordenen, aber zurückgezogenen Entwurf des Bundesfamilienministeriums zur Reform des SGB VIII war dann auch eine Ergänzung des § 4 KKG enthalten, die zumindest eine Rückmeldung der Jugendämter an die Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger erlaubt hätte.
Im Arbeitsalltag bedeutet dies auch, dass z.B. bei gemeinsamen Fallkonferenzen zwischen Jugendamt und Gesundheitsamt keine Klardaten ausgetauscht werden dürfen, wenn der/ die Betroffene nicht zugestimmt hat.
Das Problem ist mit hoher Wahrscheinlichkeit darin begründet, dass der Gesetzgeber es versäumt hat, die jeweils korrespondierenden Gesetze aneinander anzugleichen. So ist das Jugendamt verpflichtet, ein Netzwerk Frühe Hilfen aufzubauen, aber die potentiellen Netzwerkpartner sind nicht zur Teilnahme verpflichtet bzw. bekommen diese Teilnahme irgendwie vergütet. So dürfen Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger zwar dem Jugendamt ihre Beobachtungen und Erkenntnis übermitteln, aber das Jugendamt ist zu einer inhaltlich substantiellen Rückmeldung nicht berechtigt. Auch der Schulbereich hat in Niedersachsen noch nicht die Regelungsdichte in diesem Bereich, wie es für ein funktionierendes Netzwerk Kinderschutz (um nicht nur den Focus auf die Frühen Hilfen zu legen) erforderlich wäre. Nun muss man zwar in Rechnung stellen, dass der Aufbau der Netzwerke Früher Hilfen flächendecken und konsequent auch in Niedersachsen erst ab Ende 2012 begonnen hat und hier auch noch eine längere Entwicklungszeit in Rechnung gestellt werden muss, dennoch resultieren eine Reihe der Umsetzungsprobleme im Arbeitsalltag aus der nicht miteinander kompatiblen rechtlichen Regelungen für die unterschiedlichen, zur Zusammenarbeit aufgeforderten Berufsgruppen. Insofern ist zu erwarten, dass die Erkenntnisse aus diesen Umsetzungs"problemen" auch künftig zu Diskussionen und sicherlich auch zu Nachbesserungen zumindest des SGB VIII führen werden. Wünschenswert wäre aber immer wieder auch eine Anpassung der Regelungen in den anderen Gesetzen, in denen Regelungen für die Berufsgruppen enthalten sind, die nicht in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, mit dieser aber zusammenarbeiten sollen.
Eines aber bleibt dabei unverzichtbar: die beiden Grundsatzurteile des BVerfG zur informationellen Selbstbestimmung und zum Vertrauensschutz müssen auch künftig die Grundlage bilden, so schwierig das im Einzelfall gerade im Kinderschutz auch sein mag und auszuhalten sein wird.Dr. Dirk Härdrich